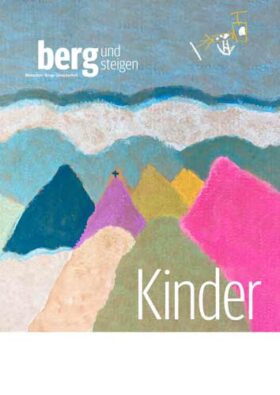FOMO: Haben Profis wie Babsi Zangerl & Co. Angst, etwas zu verpassen?
Die Angst, etwas zu verpassen, ist die Essenz des Begriffes FOMO – der Fear of Missing Out. Vier Größen der Bergsportszene haben uns erzählt, welchen Stellenwert Social Media in ihrem Alltag und ihrer Arbeit hat, wie sie mit der Versuchung umgehen, ständig online zu sein, und welche Vorteile, aber auch Nachteile sie in der digitalen Welt sehen. Spannend dabei: Alle vier betreiben ihre Social-Media-Kanäle selbst.
Babsi Zangerl
Babsi Zangerl, 36 Jahre alt, Arlbergerin, ehemals Boulder-Profi, heute eine der erfolgreichsten Big-Wall-Kletterinnen der Welt.

„Ehrlich gesagt, kenne ich diese Angst nicht. Ich lasse mich nicht so von Social Media beeinflussen, aber es gehört als Profi einfach dazu, präsent zu sein. Social Media hat großen Einfluss auf andere Menschen, etwa wenn jemand an einem bestimmten Ort mit perfekten Bedingungen klettert. Dann wollen andere dort auch hin. Aber es gibt immer das Risiko, dass Menschen sich über schätzen, weil sie nur das Endergebnis sehen – das perfekte Bild, den gelungenen Versuch –, aber nicht die Rückschläge und die Herausforderungen. Beim Klettern ist das Risiko vielleicht etwas kleiner, weil man schnell merkt, wenn man an seine Grenzen kommt.
Aber bei anderen Sportarten, wie zum Beispiel Paragliden oder Skifahren, kann das gefährlicher sein. Man sieht vielleicht jemanden eine unberührte Abfahrt fahren oder von einem Gipfel starten und denkt, man könnte das auch, ohne die Risiken zu kennen.
Perfekte Bilder verleiten dazu, Risiken zu unterschätzen
Man muss sich bewusst sein, dass Social Media nicht die Realität zeigt. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Früher gab es Social Media nicht, da musste man sich mehr auf sein eigenes Gefühl verlassen. Heute ist die Welt durch Social Media visuell greifbarer, aber die perfekten Bilder verleiten oft dazu, die Risiken zu unterschätzen. Früher hat man seine Geschichten über Magazine erzählt, aber die gibt es im mer weniger.
Heute ist Social Media das einfachste Tool, um Leistungen oder Projekte zu teilen. Für mich ist wichtig, dabei authentisch zu bleiben. Ich poste gerne über meine Projekte und Reisen, weil es sich gut und natürlich anfühlt. Aber wenn ich zu Hause in der Halle trainiere, denke ich oft: Wen interessiert das? Das fühlt sich nicht authentisch an, und deshalb poste ich das eher selten.
Ich möchte nicht auf die ‚Influencer-Schiene‘, bei der alles perfekt inszeniert sein muss. Für mich steht bei meinen Projekten immer mein persönliches Ziel im Vordergrund, und Social Media läuft nebenbei mit. Social Media hat den Sport gerade für Freestyle-Aktivitäten wie Felsklettern oder Freeriden zugänglicher gemacht und ermöglicht es mehr Menschen, davon zu leben. Aber ich finde, dass es nicht immer nur um Rekorde gehen sollte. Über das Scheitern kann man auch gute Geschichten erzählen.
Nicolas Hojac
Nicolas Hojac, 32 Jahre alt, Schweizer (Speed-)Bergsteiger, Ausbildung im SAC-Expeditionsteam. Expeditionen nach Indien, Pakistan, China, Nepal und Patagonien.

„FOMO kenne ich weniger von Social Media, sondern eher vom Wetterbericht. Zum Beispiel steht im Frühjahr ein neues Projekt in den Alpen an. Dafür halte ich mir zwei Monate frei, um ganz flexibel auf das Wetter reagieren zu können.
Sonst habe ich Angst, ein gutes Wetterfenster zu verpassen. Aber es ist nicht so, dass ich durch Social Media scrolle und das Gefühl habe, etwas verpasst zu haben, wenn andere guten Schnee oder ideale Bedingungen in der Eiger-Nordwand hatten. Bei manchen kommt da auch ein bisschen Neid auf. Wenn eine Seilschaft etwas Cooles gepostet hat, versuche ich, das in Relation zu setzen.
Ich habe eher Angst, ein gutes Wetterfenster zu verpassen

Mit mir sitzen dann wahrscheinlich 10.000 andere auch zu Hause und haben es verpasst. Es ist nicht so, dass Zehntausende die coolsten Routen geklettert sind und ich der Einzige war, der zu Hause geblieben ist. Social Media spielt aber leider auch bei mir eine große Rolle. Als Profi gehört es dazu. Ich betreue meinen Insta-Kanal selbst, obwohl ich ihn gerne abgeben würde.
Aber so bleibt es authentischer und ich kann auf Nachrichten und Kommentare aus der Community antworten. Das ist auch eine Art der Wertschätzung. Wenn ich auf Speed-Projekten unterwegs bin, komme ich gar nicht dazu, viel Material zu sammeln. Im Sommer habe ich mit Adrian Zurbrügg das „Berner Panorama„, also zehn Gipfel, in 37 Stunden und fünf Minuten nonstop überschritten.
Du bist da permanent in ausgesetztem Gelände unterwegs und hast keine Zeit für Fotos. Wir sind dann später noch mal mit einem professionellen Film- und Fototeam zurückgekehrt, um Material aufzunehmen. Für mich ist es schöner, ein Projekt ohne Kamerabegleitung umzusetzen, weil ich es in erster Linie für mich mache. Ich will herausfinden, ob das, was ich mir vornehme, überhaupt möglich ist. Im Zweifel kann ich ein Projekt aus Sicherheitsgründen auch abbrechen.

Ich denke, dass Social Media das Bergsteigen stark verändert hat. Wenn jemand etwas postet, bekommt die ganze Welt es mit und die Routen werden überlaufen. Besonders beim Klettern von Nordwänden und beim Eisklettern merke ich das sehr. Es kommt vor, dass Leute mir Informationen geben, aber mit der Bitte, diese nicht in den sozialen Medien zu teilen.
Durch den Klimawandel verschärft sich das noch, weil zum Eisklettern immer weniger Zeit im Jahr bleibt. Auch ich habe schon Situationen erlebt, in denen nach uns noch einige Seilschaften in einen Eisfall ein gestiegen sind. Wir sind dann lieber vorzeitig umgekehrt, um uns nicht in eine gefährliche Lage zu bringen.“
Laura Dahlmeier
Laura Dahlmeier, 31 Jahre alt, ehemalige Biathlon-Weltmeisterin und Olympiasiegerin aus Garmisch-Partenkirchen, heute privat und als Bergführerin in den Bergen unterwegs.

„Um ehrlich zu sein, musste ich FOMO erst googeln. Social Media spielt eine wichtige Rolle in meinem beruflichen Alltag, gerade als Bergsportlerin und Markenbotschafterin. Es ist Teil meiner Arbeit geworden und ersetzt für mich die klassische Homepage. Es bietet mir die Möglichkeit, meine Erlebnisse mit der Community zu teilen und selbstbestimmt zu posten. Mit Social Media kann ich meine Geschichten selbst erzählen, anders als in Magazinbeiträgen oder in Zeitungen, wo andere über mich schreiben.
Für mich überwiegen die Vorteile, auch wenn Social Media manchmal eine zu große Bedeutung einnimmt. Ich betreue meinen Instagram-Kanal selbst, nur gelegentlich übernimmt meine Managerin etwas, wenn ich keine Zeit habe. Früher hatte ich eine Agentur mit Redaktionsplan, aber das hat für mich nicht funktioniert, da ich mein Leben nicht so durchplanen kann und will.

Ich will nicht dazu gezwungen sein, für Bilder eisklettern zu gehen, wenn ich an diesem bestimmten Tag lieber Skitour gehen will. Wichtig ist mir, dass Social Media mir entspricht – es macht mir Spaß, aber ich will mich nicht unter Druck setzen lassen, ständig perfekte Bilder zu liefern. Ich mache die Touren, weil ich Freude daran habe, nicht zur Inszenierung. Oft ist mein Handy dabei aus.
Ich kann meine eigenen Geschichten erzählen – anders als in Magazinen, wo andere über mich schreiben
Wenn sich gute Fotos ergeben, entstehen sie meist nebenbei. Social Media hat den Bergsport definitiv verändert. Viele Menschen nutzen Plattformen wie Instagram nicht nur zur Inspiration, sondern auch zur Recherche über Tourenbedingungen. Das kann zu einem ‚Run‘ auf bestimmte Orte führen, was problematisch ist – vor allem bei riskanten Touren oder sensiblen Bedingungen wie Neuschnee.
Deshalb überlege ich genau, was ich poste. Oft teile ich Bilder erst, wenn die Bedingungen sich geändert haben, um Nachahmer zu vermeiden. Als Markenbotschafterin habe ich da eine gewisse Verantwortung. Trotzdem möchte ich über meinen Kanal niemanden belehren.“
Hanspeter Eisendle
Hanspeter Eisendle, 68 Jahre alt, aus Sterzing in Südtirol, Bergführer und Kletterer, Freikletterpionier an den Dolomitenwänden, in jungen Jahren an diversen Himalaya-Expeditionen beteiligt.

„Aus meiner Sicht hat sich das Bergsteigen durch die ständige Erreichbarkeit und die permanente Kommunikation über Social Media grundlegend verändert. Früher war ein echtes Abenteuer immer auch mit einem gewissen Maß an Isolation verbunden. Ich konnte mich voll und ganz auf die Natur und die Herausforderungen konzentrieren, die der Berg mir stellte.
Genau das macht für mich den Wert des Bergsteigens aus. Heute jedoch bleibt man selbst in den entlegensten Regionen der Welt immer in Verbindung mit der Außenwelt. Social Media schmälert das Abenteuer. Man ist ständig erreichbar, bekommt Updates und tauscht sich in Echtzeit aus. Es gibt diesen Drang, alles sofort zu teilen, zu posten und zu zeigen, was man gerade erlebt.
Früher war echtes Abenteuer mit Isolation verbunden.
Aber ich will die Vergangenheit nicht idealisieren – früher war nicht alles besser. Die Welt ändert sich ständig mit uns, und es ist nicht möglich, die Zeit zurückzudrehen. Man passt sich an, nutzt die neuen Möglichkeiten – und wenn es zu viel wird, kann man sich auch zurückziehen. Ich sehe mich als Bergsteiger und Bergführer. Mit 200 bis 250 Tagen an geführten Touren im Jahr ergänzt sich das sehr gut.
Dadurch brauche ich auch keine ständige Präsenz in den sozialen Netz werken. Tatsächlich bin ich mittlerweile an einem Punkt, an dem ich eher Werbung abbauen muss, weil ich nicht allen Anfragen gerecht werden kann. Von meinen größten und wildesten Abenteuern gibt es übrigens keine Bilder – da war ich mehr damit beschäftigt, zu überleben.
Bei den jüngeren Bergführern ist das anders. Für sie ist Social Media ein wichtiges Mittel, um überhaupt erst Bekanntheit zu erlangen. Anders als etwa beim Ski-Weltcup lässt sich das Bergsteigen nicht messen oder vergleichen. Im Grunde bemisst sich der Wert einer Unternehmung nach der Geschichte, die man erzählen kann – und heute spielen dabei auch Bilder und Filme eine große Rolle.
Reinhold Messner, mit dem ich auf einigen Expeditionen unterwegs war, war einer der ersten ‚Berg-Influencer‘. Er hat das Bergsteigen extrem geprägt, etwa in dem er den Alpinstil in den Himalaya übertragen hat. Aber er hat erst geliefert und dann erzählt. Heute ist das anders. Durch Social Media entsteht oft der Druck, schon vorab zu erzählen, wo hin man fährt, währenddessen aus dem Zelt zu berichten und anschließend die Geschichte auszuschmücken.
Es entsteht der Druck, schon vorab berichten zu müssen – und aus dem Zelt zu berichten.
Das setzt einen unter Druck und kann es erschweren, vor Ort vernünftige Entscheidungen zu treffen. Ich würde mir wünschen, dass die Geschichten wieder mehr in die Tiefe gehen.“