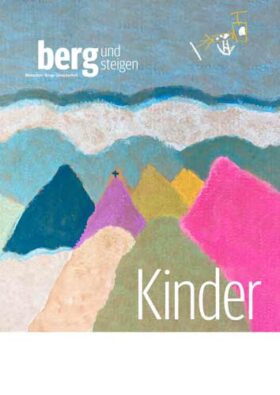„Free Solo“ und warum man nicht darüber schweigen kann

Noch mehr spannende Beiträge im neuen Jahrbuch des Alpenvereins BERG 2026.
Ab sofort hier erhältlich.
Am 18. Mai 2024 stürzte Martin Feistl, einer der stärksten jungen deutschen Alpinisten, free solo kletternd aus der Spitzenstätter (180 m, VII) an der Scharnitzspitze im Wetterstein tödlich ab. Neben Schock, Schmerz und Trauer bleibt die Frage stehen: Musste das sein? Und: Hat vielleicht medialer Erfolg dazu beigetragen, dass Martin Feistl seine Grenzen überreizt hat?
Für die Redaktion der Jahrbuch-Ausgabe BERG 2026 war die Antwort darauf der hier vorliegende Versuch, das Thema „Free Solo“ tiefer zu durchleuchten – also auch die Frage: Was treibt Menschen dazu, ihr Leben in dieser Weise aufs Spiel zu setzen? „Und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein“, dichtete Schiller im Sturm und Drang.
Und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein.
Schiller
„Am Rande des Todes wollen wir dem wonnigen Leben entgegenjodeln“, fabulierte der Vogelwild-Bergsteiger Eugen Guido Lammer, der dann immerhin 82 Jahre alt wurde. Und Reinhold Messner, der 2024 auch seinen 80er feiern konnte, definiert die Essenz des Alpinismus mit der Aussage: „Ich gehe dahin, wo ich sterben kann, sterbe aber nicht.“ Solche Sätze mögen markig klingen, bleiben allerdings im Hals stecken, wenn ein Leben eben nicht gewonnen, sondern verloren wird.

Und der vermeintliche Trost „Er starb bei dem, was er am liebsten tat“ hinkt, wie ein US-Autor einmal geschrieben hat. Denn: „Was er am liebsten tat, war leben.“ Leben ist lebensgefährlich. „You only live once“, sagt Charly Brown von den Peanuts – und Snoopy antwortet: „Nein, wir sterben nur einmal; bis dahin leben wir.“
Nicht dem Leben Tage geben, sondern den Tagen Leben. „It’s better to burn out than to fade away“ (Neil Young). Lieber ein Tag lang Tiger sein als ein Leben lang Bettvorleger. Es gibt viele schlaue Sprüche, die uns helfen sollen, das Beste aus dem großartigen Geschenk des Lebens zu machen. Andererseits ist auch der Selbstmord(versuch) nicht strafbar.
Unsere Gesellschaft gibt uns die Wahlfreiheit, dieses Leben bestmöglich mit Sinn zu füllen oder es zu beenden. Und Freiheit gilt gerade am Berg als höchstes Gut. Formulieren wir also eine These, deren einzelne Elemente die folgenden Betrachtungen strukturieren sollen:
Free Solo ist ein Ausdruck der Freiheit in den Bergen, sein Risiko selbst zu wählen.
1. Risiko – am Berg immer präsent
„Es braucht keinen K2 zum Sterben, auch am Wanderweg kannst du abstürzen. In anderen Sportarten ist die Amateurliga vergleichsweise harmlos, aber Bergsteigen kannst du nicht mit 50 Prozent betreiben: Absturzgelände ist halt Absturzgelände.“ Das sagt Dani Arnold, bekannt durch Speed-Solos der großen Nordwände. Das Wort „Absturzgelände“ liest man vielleicht im Führer, in der Praxis scheinen es viele nicht zu erkennen.
Schon beim Wandern können eine steile Wiese oder lichter Wald, ein Bachgraben oder ein Schneefeld genügen, damit aus einem Stolperer ein finaler Absturz wird, der womöglich durch Anprall an einem Baum oder Felsblock endet. „Is this free soloing or is it hiking? You can walk up without hands, but you can fall down easily“, philosophiert Alex Honnold im Schrofengelände.

Diese Konsequenz war den drei Männern wohl nicht bewusst, die im Inntal einem Online-Track folgten und über einen steilen, feuchten Schrofenhang zu Tode stürzten – einer nach dem anderen. Rote und schwarze Wanderwege sind dadurch definiert, dass auf kurzen oder auch längeren Passagen ein tödlicher Absturz möglich ist. Nicht viel anders als Leitersteigen – bei dem allerdings auch viele fallen – ist „leichtes“ Klettern.
Beim Zustieg zu alpinen Kletterrouten ist es oft üblich, teils brüchiges Steilgelände im zweiten bis dritten Grad ungesichert zu bewältigen, bevor man am Einstieg das Seil anlegt. Und auch die Abstiege bieten oft Kletterstellen, die man trotz Müdigkeit seilfrei abklettert, statt zu sichern oder abzuseilen. Schon allein, weil beides zu lange dauern würde.
Wer einmal an den Sellatürmen war, weiß, wovon die Rede ist. Dazu drängt oft die Zeit, und so wird gerade bei größeren alpinen Routen immer wieder auf die Seilsicherung verzichtet: an den Eisfeldern der Eiger-Nordwand, im Firnteil des Biancograts oder an den Plattenstufen der Watzmann-Ostwand. Wobei es nicht nur ehrlicher, sondern auch sicherer ist, das Seil dann gleich ganz abzulegen. „Gleichzeitiges Gehen am (kurzen) Seil“, in der Schweiz immer noch hochgelobt, ist in Wahrheit multiples Free Solo, das die Zahl der von einem Sturz Betroffenen vervielfacht.
Denn ein Seil, das nicht durch Fixpunkte läuft, überträgt nur die Kraft des Sturzes – und die kann weder ein Luis Trenker noch ein Sylvester Stallone freistehend halten. Doch auch wenn man sich zur Seilschaft verbindet, gerät man im alpinen Gelände oft in eine Art Free-Solo-Modus, wo ein Sturz tabu ist. Denn anders als beim Sportklettern stecken nur hier und da Schlaghaken von dubioser Haltekraft, und selber Keile oder Friends zu legen kostet Zeit, und man hat’s ja eh im Griff … und dann kommt ein loser Griff, ein nasser Tritt … Im Karwendelbruch oder im Röhreneis weiß man eh nicht so genau, wie solide das Material überhaupt ist.
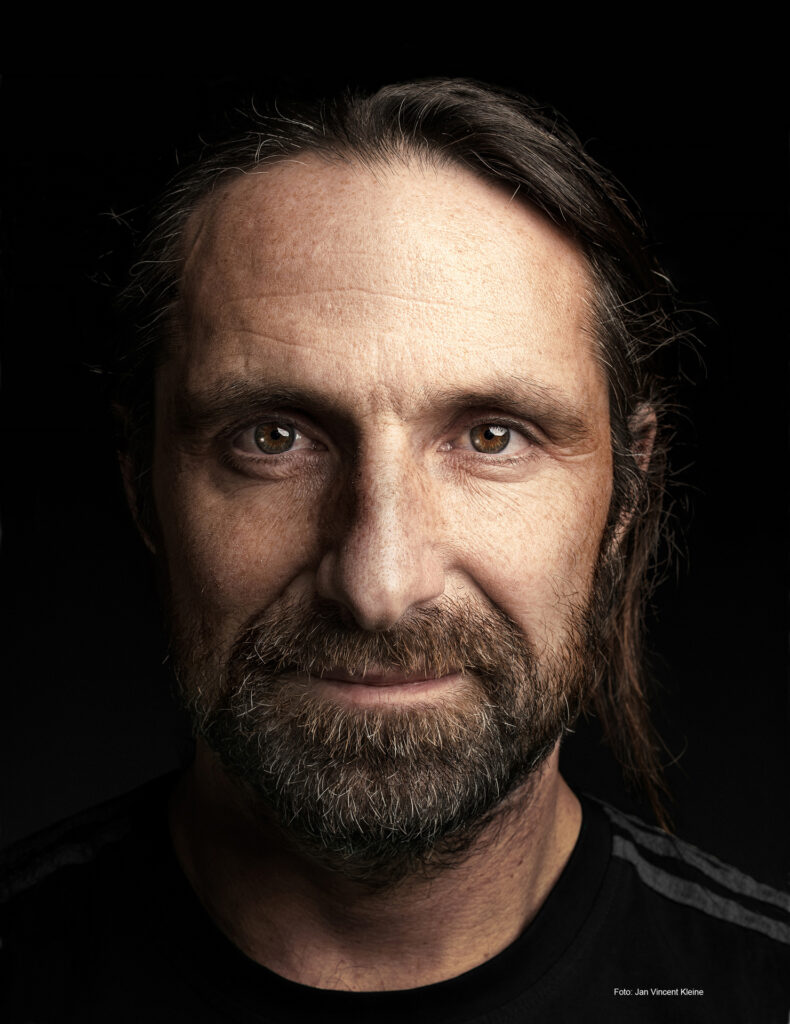
Mit zunehmendem alpinem Anspruch wird das Risiko schwerer kalkulierbar, die Grenze zum Free Solo schwammiger. Warum also nicht gleich bewusst allein losziehen? Es darf ja gerne innerhalb des „Wellnessbereichs“ sein, mit großem Sicherheitspuffer zur persönlichen Grenze und mit solider Dreipunkt-Technik. Watzmann-Ostwand, Kopftörlgrat, Jubiläumsgrat … schon die Dreitorspitz-Überschreitung oder der Normalweg auf die Parseierspitze kann zum beglückenden Micro-Adventure werden.
Nun gibt es aber auch Menschen, die dieses seilfreie Alleinklettern gerne weiter treiben möchten, bis an ihre persönlichen Grenzen. Die Marge zur eigenen Spitzenschwierigkeit kann dabei sehr klein werden, der Raum für Fehler und Fehleinschätzungen minimal. Besonders spektakuläre Akteure wurden dadurch berühmt: Alex Huber, Alain Robert, Dani Arnold, Alex Honnold. Andere starben dabei: Ueli Steck, John Bachar, Derek Hersey.
Ist das eine andere Welt, für selbstgefährdende Hasardeure? Oder ist es nur der logische nächste Schritt? Alex Huber sagt dazu: „Meine schwersten Free Solos fand ich persönlich nicht gefährlicher als manche Expeditionen, etwa die Latok-2-Westwand oder die Bavarian Direct auf Baffin Island. Du hast nur mehr Möglichkeiten, Mist zu bauen, und es liegt viel offensichtlicher in deiner eigenen Hand. Die Lawinengefahr auf Skitour dagegen hast du weniger im Griff als den Griff am Fels.“
Entsprechend beklagte er bei einer Diskussion angesichts der Bitte, das Risiko bei seinen Free Solos von 1 bis 10 einzustufen, dass die Skala keine 0 enthalte – während Stefan Glowacz, der nach seinen Anfängen mit dem Soloklettern bald aufhörte, die 11 wählte. Es gehört zu den Grundideen des Alpinismus, Risiken einzugehen und verantwortlich mit ihnen umzugehen.
Bei manchen Menschen wird die Risikosuche zum Selbstzweck. Gut wäre, sich bewusst zu machen, mit welcher Einstellung man die genannten Disziplinen betreiben will, statt unbedarft in sie hineinzustolpern. Free Solo ist eine Spielform unter vielen und sicher die kompromissloseste. Oder, mit den Worten von Dani Arnold:„Free Solo ist die ultimative, die Königsdisziplin, aber es ist natürlich auch die dümmste, absolut gefährlichste Spielart des Kletterns.“
2. Berge – Leidenschaft und Lohn

„Und trotzdem mach ich’s“, fährt Arnold fort; er liebt das Klettern ohne Last: „Du hast einfach nichts mehr dabei.“ Eine geschmeidige Leichtigkeit des Seins könne man dabei erleben, das sagt auch der Tiroler Bergführer Albert Neuner: „Free Solo ist leicht und frei: Du kennst die Route, kannst es voll genießen, kannst durchcruisen, dich spielerisch durchschlängeln. Wenn du in den Flow reinkommst, ist das Gefühl unbeschreiblich, macht fast süchtig.“
Und er ist sich aus diesem Grund sicher: „Standards im Schüsselkar bis zum oberen sechsten Grad werde ich klettern, bis ich nicht mehr raufgehen kann.“ Robert Jasper sieht es als Lernchance: „Du bist dein eigener Chef. Entwickelst dich zu einem selbständigen Bergsteiger, der alle Entscheidungen selber treffen, alles selber machen und ausbaden muss – ein Reifungsprozess, eine harte aber wertvolle Schule.“

Das kann ich. Das will ich. Das tue ich. Jetzt. Auch ohne Hilfe eines Partners und das Seil sozusagen als doppelten Boden, in der richtigen Einschätzung von Gelände und Können. Auch in heiklen Situationen cool bleiben, das kann Stärke und Selbstwirksamkeit erleben lassen. Maximal in der Auseinandersetzung mit der Angst vor dem Tod, der hier besonders präsent ist. Für Alain Robert – bekannt als Gebäudekletterer und für Solos im Fels bis zur Schwierigkeit 8b, als 8c die Grenze war – ist das wesentlich:
„Ich war ein Junge, der vor allem Angst hatte und mutig werden wollte. Ich hatte Angst vor dem Tod, der Leere, dem Absturz. habe ich es geschafft, das zu besiegen, was meine größte Angst war.“ Zudem ist Free Solo einfach praktisch: Man muss keinen Partner suchen, sich nicht abstimmen – kann sich andererseits aber auch nicht motivieren oder helfen lassen –, muss nicht viel Ausrüstung mitschleppen, nicht mit Sicherungen und durch Seilzug den Bewegungsfluss stören, ist schneller wieder daheim.
Für Robert Jasper war es eine Notlösung: „Mit 20 hatte ich in der Bergführer-Ausbildung am Wochenende Gäste und unter der Woche Zeit, aber keine Partner. Dann bin ich halt solo dorthin, wo ich gute Verhältnisse gesehen habe und wo meine Träume warteten.“ Dani Arnold sieht noch einen anderen Lohn im Free Solo: „Es ist reduziert aufs Wesentliche und fordert absolute Ehrlichkeit. Ich kann mich nicht selber bescheißen.

Das ist wichtig in der heutigen Zeit, wo alles reguliert wird, niemand mehr an etwas schuld sein will. Da ist Free Solo schon ein Commitment.“ Und sein Gewinn liege im Prozess: „Die extreme Auseinandersetzung, die jahrelange Vorbereitung auf den Moment – daran wachse ich, das bringt mich weiter. Ob ich einsteige oder nicht, ist dann gar nicht so wichtig.“
Unabhängigkeit, Flow, Souveränitäts-Erleben, Selbstbestätigung, Prüfung für realistische und ehrliche Selbsteinschätzung, Training im Angstmanagement … beim Free Solo lässt sich vieles lernen, was im Bergsport und fürs Leben wichtig ist, und das in extremer Intensität. So ist für Alex Huber das Free Solo nur die „von außen betrachtet krasseste Form“ des Alpinismus, es gehe aber immer ums Gleiche: „Die äußeren Bedingungen, die Kraft und die geistige Verfassung, alle drei müssen zusammenpassen.“

3. Freiheit? Braucht Verantwortung!
Diese zwei Begriffe, Freiheit und Verantwortung, sind nicht von ungefähr im DAV-Leitbild verknüpft. Für Alex Huber heißt das: „Ich probier, was geht, aber immer mit Hirn. Ich will das Risiko im Griff haben.“ Nur: Wie gelingt das, was so leicht gesagt ist? Wie lässt sich Free Solo (und all seine oben genannten Alltagsformen)„vernünftig“ betreiben? Es beginnt lange vor der eigentlichen Aktion mit dem, was in den wenigsten Videos und Reportagen gezeigt wird: der Vorbereitung.

Das ist allgemein das lebenslange Lernen und Training für Körper und Geist – Albert Neuner: „Ich hab mich von Kind auf gesteigert, vom zweiten, dritten Grad her.“ Im Speziellen ist es dann die Vorbereitung auf das Projekt. Neuner klettert schwierige Soloprojekte so oft mit Seilpartnern, „bis es passt“. Auch der Kontrollfreak Alex Huber studierte die Hasse-Brandler (500 m, VIII+) an der Großen Zinne gründlich ein, markierte Griffe mit Magnesia.
Als Daniel Gebel erzählte, er habe einen davon ausgerissen, entgegnete er: „Ich wusste genau, an welchem Griff ich wie stark ziehen durfte.“ Dani Arnold oder Albert Neuner dagegen verzichten auch mal aufs Üben des letzten Details, um eine gewisse förderliche Spannung zu erhalten. Und Robert Jasper ging manche Alpintour gar free solo onsight –„das ist die Königsdisziplin, natürlich nochmal ganz was anderes; für mich aber was ganz Persönliches, über das ich in der Öffentlichkeit nicht gerne reden will“.
Nur: Wann ist der so wichtige, richtige Moment? Neuner muss „komplett rein im Kopf sein, es darf kein privates Problem im Weg stehen“. Für Arnold ist das Bauchgefühl das wichtigste Warnsignal: „Bei schlechtem Gefühl lass ich’s sein.“ Jasper differenziert das „innere Gefühl“ aus: „Zweifel und Angst gehören immer dazu, sie sind gesunde Warnsignale.
Du musst den verantwortungsvollen Umgang damit lernen, damit die Angst dich nicht plötzlich anspringt und überwältigt – sonst stürzt du ab.“ Alex Huber hatte am Schleierwasserfall, vor dem Free Solo in Kommunist (X+) und dem Rotpunkt in Open Air (XI+), seine „Ritualzüge“ und Testboulder, an denen er schon beim Aufwärmen merkte, „ob Grip und Haut, Schädel und Strom passen“. An der Hasse-Brandler kletterte er nach fünf Metern wegen einem Zuviel an Nervosität zurück.

Dann stieg er mit dem Bewusstsein, auf den ersten 80 Metern noch abklettern zu können, nochmal ein. „Am Point of no Return habe ich einen kurzen Moment bewusst innegehalten, um zu entscheiden ob ich weiterklettern will; sobald der Fuß über dem Überhang war, war es entschieden.“ Was Free Solo für viele so wertvoll macht, ist die Bewusstheit, diese absolute Fokussierung – und dass die innere Balance noch präziser stimmen muss als am Seil in ernsten Touren. Dazu gehört auch das Umdrehen.
Womöglich schon zu Hause, indem man gar nicht erst losfährt. So wie Dani Arnold, der „ungefähr in der Hälfte der Fälle gar nicht erst gestartet“ ist. Oder man dreht am Wandfuß um. Robert Jasper brach solo die kaum wiederholte Harlin-Winterdirettissima am Eiger dreimal ab –„immer war’s saukalt und halt doch ne Nummer zu groß“ –, später schaffte er mit seinem Partner Roger Schäli die erste freie Begehung. Nur wer umdreht, kann wiederkommen, heißt eine alte Bergsteigerweisheit.
Potenzial für Fehler und Fehleinschätzungen bleibt genug. So erinnert sich Neuner an die Crux in Locker vom Hocker (250 m, VIII) im Schüsselkar: „Ich greif auf die Leiste, denk, scheiße ist die klein, ist das überhaupt die richtige? Hab ich so dünne Haut oder so schwitzige Finger? Dann hab ich noch mal hingegriffen; es gibt nur die.

Also gleich weitergezogen und durchgeklettert, bevor noch Stress aufkommt. Danach bin ich auf dem Band gesessen und hab gedacht: Die Leiste – huiuiui. Die fühlt sich ohne Seil viel kleiner an als mit.“ Bei Dani Arnold lief es in der Carlesso (650 m, VIII+) am Torre Trieste andersrum: „In der Crux hab ich mit meinem 8b-Niveau nicht unendlich viel Marge. Beim Üben hab ich beide Male am Haken gezogen, weil ich in die dubiosen Haken nicht stürzen wollte.
Ich wusste aber, wenn ich ohne Seil komme, geht’s. Da stimmt schon viel im Kopf.“ Es kann aber auch anders ausgehen: Arnold erzählt von einer Vierertour in der Zentralschweiz, in die er übermütig mit wenig Material und ohne Kletterschuhe reinrumpelte und die sich dann als „viel schwieriger als erwartet“ entpuppte; merke: „Je kompetenter du bist, desto mehr Dummheiten machst du bei den leichten Sachen.“
Vermeintlich einfache Routen wurden schon für viele Soloisten zur Routinefalle: Die US-Legende John Bachar etwa starb an der relativ leichten Dike Wall, der Allgäuer Egbert Lehner in der Schuster-Führe am Hochwiesler, die er oft solo gemacht hatte. Und Jonas Hainz, der mit Moulin Rouge (400 m, 9–), einer Erstbegehung seines Vaters Christoph an der Rotwand, eines der schwierigsten Solos aller Zeiten gemacht hatte, stürzte aus einem Vierergrat am Magerstein.
Auch ich persönlich könnte die Liste von unangenehmen „Hätt net solle“-Erlebnissen noch deutlich verlängern … und trainiere gezielt, nicht unbedingt stolz zu sein, aber zufrieden, wenn ich mich zum Umdrehen oder Verzichten entscheide.
Das Alpenvereinsjahrbuch BERG 2026 jetzt online bestellen.
4. Selbst gewählt? Oder fremdbestimmt?
Das letzte Element unserer These ist besonders schwierig zu differenzieren. Denn was uns im Innersten bewegt und antreibt, ist oft eine unklare Melange; irgendwie bestimmt halt auch das Sein das Bewusstsein, ist der vermeintlich freie Wille ein Rechenergebnis aus den diversesten, internen wie externen Inputs. „Die Sponsoren treiben ihre Athleten zu wahnsinnigen Aktionen“, hört man oft.
Dieser Verdacht mag bei manchen Firmen eher begründet sein als bei anderen, und Newcomer mögen eher als etablierte Profis bereit sein, große Risiken für öffentlichkeitswirksame Stunts einzugehen. Doch in echt lebensbedrohlichen Situationen dürften die monetären Argumente in den Hintergrund treten, dann zählen nur Können und Wollen.
Nahe verwandt damit ist die Inspiration (Verführung?) durch mediale (Vor-)Bilder. Stefan Glowacz an der Dachlippe von Kachoong, Wolfgang Güllich in Separate Reality, Patrick Edlingers Film „Leben an den Fingerspitzen“: Inszenierungen von Schönheit, Eleganz und Stärke im Angesicht der Todesgefahr – sie haben sicher auch in vielen den Gedanken getriggert: „Kann ich so was auch?“
Andererseits ist Eigenverantwortung einer der wichtigsten Werte im Bergsport: Die Aufgabe herauszufinden, was man wirklich will und wie man es realisieren kann, um dem Leben Fülle zu geben. Was einem bei dieser Selbsterforschung in die Quere kommen kann, sind das soziale Umfeld, der Zeitgeist, die Traditionen und Kulturen der Sportcommunity.

Das alpine Klettern entstammt einer Zeit, in der mangelnde Sicherung durch innere Sicherheit kompensiert werden musste. Oder durch den Mut, den man zur Zeit der Weltkriege ohnehin erlebt hat. Um 1900 wurden viele Erstbegehungen wie der Kopftörlgrat oder etliche ernste Vierer in meiner Kletterheimat Battert free solo gemacht – es war ja nicht viel gefährlicher als schultergesichert mit Hanfseil.
Den anspruchsvollen Hallweg (IV+) in der Falkenwand solo abzusteigen, wenn man dort eine schwere Tour klettern wollte, war die Erwartung in der „Horror Gilde Battert“. Und noch „in den 1980er Jahren galt Heldentum beim Klettern viel, und bei den großen Vorbildern Güllich oder Albert waren schwierige Solos an der Tagesordnung“, schreibt Irmgard Braun, die damals bis 7– solo kletterte, um zu beweisen, „dass Frauen auch anders sein können.
Ich wollte eine Amazone sein, stolz, kühn, unabhängig von Männern. Nicht nur beim Klettern.“ Mut gehört fast immer zum Bergsteigen, Kühnheit übersteigert ihn zum Selbstzweck. In manchen Kletterregionen oder In-Groups wird heute noch Kühnheit hoch bewertet bis verherrlicht und oft verbunden mit unterschwelligen Männlichkeitsidealen.
Es kann kein Zufall sein, dass außer Steph Davis und Brette Harrington kaum Frauen mit Free Solos Schlagzeilen machten. Vom Free-Solo-Propheten Paul Preuss stammt der Satz: „Der Gedanke, wenn du fällst, hängst du drei Meter am Seil, hat geringeren ethischen Wert als das Gefühl: ein Sturz und du bist tot.“ Ist das ethisch? War Ethik nicht die Kunst des richtigen Lebens und Handelns?
Gebi Bendler, Chefredakteur des Fachmagazins bergundsteigen und Laudator bei der Verleihung des Paul-Preuss-Nachwuchspreises an Laura Tiefenthaler – sie hatte die Eiger-Nordwand solo durchstiegen, einige Passagen mit Selbstsicherung –, stellte denn auch die Frage, ob Preuss, der beim Free Solo abstürzte, ein gutes Vorbild für die Zukunft eines gesunden Alpinismus sei.
Und er forderte: „Wenn wir eine Kultur schaffen wollen, in der nicht so viele Topleute sterben, müssen wir einiges ändern: … Zielvorgaben überdenken und Verzicht und gute Entscheidungen als Maßstäbe für den Erfolg einbeziehen.“ Am Rande: Für den Paul-Preuss-Nachwuchspreis 2024 war unter anderem Martin Feistl vorgeschlagen worden. Gerade für junge Männer, die ja auch in Selbstmord- und Sterblichkeitsstatistiken (und bei Alpinunfällen) überproportional vertreten sind und oft an Unsterblichkeitsfantasien leiden, sind Kühnheits-Communities ein toxischer Nährboden.

Und dennoch werden die Gladiatoren der Moderne oft zu Helden hochgelobt. Rolando Garibotti, Patagonien-Legende, verglich die postume Verleihung von Piolets d’Or an Hansjörg Auer und David Lama damit, „eine Saufparty zu veranstalten für jemanden, der an Leberversagen gestorben ist“. (Die beiden starben gemeinsam mit Jess Roskelley in einer Lawine beim Abstieg durch eine sonnige Ostwand in Kanada; nach einem Biwak wäre der Schnee gefroren gewesen.
Die Preise galten anderen Touren im Vorjahr.) Garibotti, der als junger Mann jährlich 100 Solotouren kletterte, redet von einem „positiven Feedback-Teufelskreis“. Einerseits habe er die soziale Affirmation erhalten und andererseits sei da die Freisetzung der Neurotransmitter gewesen, der falsche Eindruck von Kontrolle: „Ich bin in die Falle getappt und habe es als emotionalen Kompensationsmechanismus benutzt.
Aber ich habe gemerkt, dass es ein schwaches Werkzeug ist, um Selbstwert zu generieren. Ich hatte Glück.“ Natürlich kann der Drang zur Grenze auch von innen kommen. Wie bei Alex Huber, der in jeder Disziplin „meine Grenzen ausloten“ will. Oder beim 62-jährigen Alain Robert: „In den 80ern war mein Körper ein Ferrari, und ich liebte es, ihn in den roten Bereich zu treiben.
Heute ist er ein Diesel-Clio, aber ich mag es, auch meinen Diesel-Clio in den roten Bereich zu treiben.“ Nur: Wo im roten Bereich rote Linien sind, wann gesunder Ehrgeiz zu Gift wird, das ist schwierig zu unterscheiden. Besonders gefährlich ist die Souveränitätsfalle – Dani Arnold: „Sich in der Blödheit was beweisen zu wollen ist nicht schlau.“ Und Albert Neuner sagt, es solle „Spaß machen und einen erfüllen, nicht aus Lebensüberdruss geschehen“.
Manche Psychologen unterstellen großen Alpinisten per Schreibtischdiagnose eine latente Todessehnsucht durch seelische Traumata oder psychische Störungen. Es soll hier nicht der Stab gebrochen werden über Menschen, die den Tod fanden, den sie nicht wirklich gesucht haben. Doch gelegentlich sieht oder erahnt man hinter den Kulissen seelische Abgründe und Probleme, die die Risikokontrolle aus der Balance bringen können – von Liebeskummer über Alkoholismus, Magersucht und Depressionen bis zur Frustration, nicht mehr an der Spitze zu stehen.
Und generell sind unter bekannten Soloisten wahrscheinlich einige adrenalinsüchtige „Danger Freaks“, die ihr Risiko steigerten bis zur finalen Überdosis: Dean Potter, Dan Osman, Albert Precht, Jean-Marc Boivin, Marc-André Leclerc, Andi Orgler, Patrick Berhault und viele andere starben zwar nicht bei Free Solos, aber bei anderen wilden Aktionen.
Dem Wahnsinn eine Plattform?
Selbst gestellte Aufgaben zu lösen und dabei Risiken einzugehen, ist ein Ur-Antrieb der Menschheit, ohne den es keinen Fortschritt gäbe; dem Bergsport gibt es besonderen Reiz. Alain Robert: „Selbst wenn ich ein Vogel wäre, würde ich mir die Flügel stutzen, da ich das Klettern so liebe und es mit Flügeln nicht dasselbe wäre.“
Free Solo ist eine Option in diesem Spiel, die man mit Verantwortung und Lustgewinn betreiben kann. Doch dann schreibt Olaf Perwitzschky im Magazin Alpin: „Mit der Vermarktung des Solokletterns sind die Protagonisten am Ende einer Argumentationskette mitverantwortlich für den Tod von jungen Nachwuchsathleten. Ja, eine gewagte These! Aber garantiert nicht vom Tisch zu wischen.

Und ja: Auch wir Medien tragen unseren Teil der Verantwortung dabei.“ Der Schuhhersteller Lowa, bei dem Martin Feistl einen Sponsorvertrag hatte, schreibt nach dessen Unfall an das Athletenteam, dass anspruchsvolle Free-Solo-Projekte künftig weder finanziell noch medial unterstutzt würden. Die US-Firma Clif Bar hatte schon 2014 die Sponsorverträge von Athleten gekündigt, die sich mit Free Solos profilierten. Sind tatsächlich wir Journalisten, die beispielsweise als Chronisten in diesem Jahrbuch auch über schwere Solos berichten, mit schuld daran, wenn junge Leute sich um Kopf und Kragen klettern, vielleicht weil ihnen die innere Reife (oder die finanzielle Basis) fehlt, ihre Ambitionen im Zaum zu halten?
Weil sie sich davon Anerkennung oder Sponsoring erwarten? Oder weil sie einfach in überschäumender Begeisterung ihren Idealfiguren nacheifern? Stimmt also die Gleichung Veröffentlichung = Verführung? Vielleicht heißt die konstruktivere Frage: Wie könnte die Kulturänderung bewirkt werden, die Gebi Bendler gefordert hat? Free Solos müssen nicht totgeschwiegen werden, sie verdienen die gleiche Dokumentation und Würdigung wie andere Disziplinen.
Wir sollten uns aber davor hüten, sie über alle anderen zu stellen, nur weil die Aktiven ihr Leben so offensichtlich zu Markte tragen. Spitzenschwierigkeiten werden gesichert erreicht und zeigen, wie mit Engagement Grenzen verschoben werden können – auch Trapezartisten faszinieren uns trotz Sicherungsnetz.
Wie Bendler anregte, könnte man nicht nur über die erfolgreiche Begehung schreiben, sondern auch Vorbereitungen und Abwägungen, Verzicht und Scheitern dokumentieren, die ihr vorangingen. Und damit tatsächlich Vorbilder inszenieren: für den verantwortungsvollen Umgang mit den Risiken im Bergsport – der bräuchte nämlich auch in der Breite Förderung, wenn man an fehlgeleitete Online-Track-Hinterherläufer oder unreflektierte „Am kurzen Seil“-Geher denkt.
Die 150. Ausgabe des Alpenvereinsjahrbuchs im Zeichen des Wandels

Alpenvereinsjahrbuch BERG 2026
BergWelten: Großvenediger
BergFokus: Wandel
Herausgeber: Deutscher Alpenverein, Österreichischer Alpenverein und Alpenverein Südtirol
Redaktion: Axel Klemmer, Tyrolia-Verlag
256 Seiten, ca. 280 farb. Abb. und ca. 50 sw Abb., 21 x 26 cm, gebunden
Tyrolia-Verlag, Innsbruck – Wien 2025
ISBN 978-3-7022-4320-3
€ 25,–
Erscheinungstermin: 13. September 2025
Das neue Jahrbuch „BERG 2026“ ist ab sofort in allen Alpenvereinssektionen, im Buchhandel oder im DAV Onlineshop erhältlich. Mit dem Band erhalten Alpenvereinsmitglieder kostenlos die brandneue Alpenvereinskarte Venedigergruppe im Maßstab 1:25.000. Preis: € 25,-