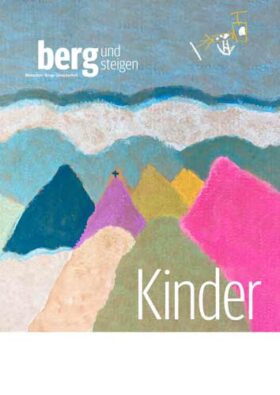Die Rega: Luftrettung in den Alpen
Im November 1946 strandete ein amerikanisches Transportflugzeug vom Typ DC-3 Dakota auf dem Gauligletscher im Berner Oberland. Die Rettung der unverletzten Passagiere gestaltete sich äußerst schwierig: Wetter und Abgeschiedenheit verhinderten tagelang jede Bergung. Am 24. November 1946 gelang dann das bis dahin Unmögliche: Die Schweizer Militärpiloten Victor Hug und Pista Hitz landeten mit ihren Fieseler-Storch-Flugzeugen auf dem Gletscher und holten die Verunglückten heraus. Dieses Ereignis gilt bis heute als Geburtsstunde der Luftrettung in der Schweiz.
1952 wurde die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) schließlich gegründet. Erste Rettungsversuche erfolgten damals noch improvisiert – etwa mit einem ausgedienten Ballonkorb oder Fallschirmspringern. Bald jedoch entwickelte sich die Rega zu einer hochspezialisierten Organisation. Heute betreibt die Rega eine Flotte von rund 20 Rettungshelikoptern. Neben Pilot:in gehören Notärzt:in, Paramedic und bei alpinen Einsätzen Bergretter:in zur Besatzung.

Die Rega in Grindelwald: Einsätze am Limit
Marc Ziegler ist seit über zwanzig Jahren bei der Rega und engagiert sich ehrenamtlich als Rettungsspezialist rund um den Eiger. Er hat unzählige Einsätze erlebt. Die Einsätze reichen von leichten Skiverletzungen bis hin zu ernsten Fällen: Vor wenigen Tagen hat sich der Hüttenwirt der Schreckhornhütte beim Wasserholen das Bein gebrochen und musste geborgen werden. Aber auch tragische Einsätze, wie die Bergung von tödlich verunglückten Wingsuitflyern oder Basejumpern gehören zum Berufsalltag. Ob er das Basejumpen verbieten würde? „Keineswegs“, sagt er, „ich würde es selbst tun, wenn ich noch jung wäre.“

Die Schweizerische Rettungsflugwacht in Grindelwald rückt pro Jahr zu rund 40 bis 50 Einsätzen aus. Besonders anspruchsvoll sind Rettungen in der Nacht – die Rega gehört zu den wenigen Organisationen im Alpenraum, die auch bei Dunkelheit fliegen. Spezielle Ausbildung, große Erfahrung und Nachtsichtgeräte sind dafür Voraussetzung. Etwa jede vierte Rettung findet nachts statt.
Am Eiger: Rettung zwischen Fels und Rotorenblättern
Durchschnittlich 20 Einsätze führen die Retter jedes Jahr am Eiger durch – vom Wanderer am Fuß des Bergs bis zu komplexen Aktionen in der Nordwand. Wenn es die Bedingungen erlauben, wird Marc Ziegler an einer 90 bis 110 Meter langen Winde zum Verunfallten abgelassen. Der Helikopter steht dabei nur zwei bis drei Meter von der Felswand entfernt – während Steinschlag, aber auch die schwierigen Windverhältnisse die größte Gefahr bleiben.