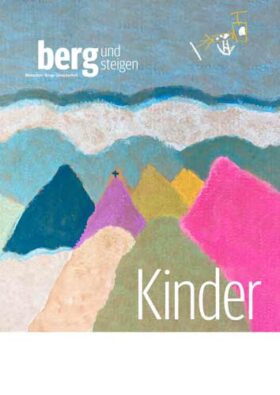Kletterroute vor Gericht: Wem gehört der Fels?
„Je höher der Einsatz, umso befriedigender ist das Resultat.“ Diese „eigentlich banale Weisheit“, die viele vom Bergsport kennen, ist das Fazit von zwei Erstbegehern zu ihrer Neutour „Tag des jüngsten Gerichts“ (700 m, VIII+/IX-, E5) in der Nordwand der Grünen Nase (Gabelekopf, 2289 m) über dem Plöckenpass.

Nun ist dieses Resultat gefährdet: Womöglich könnte sie ein Gerichtsurteil zum Entfernen der Haken aus ihrer Route zwingen. Im Juli 2022 hatten die beiden Bergführer und Führerautoren – laut eigener Einschätzung Familienväter mit „stinknormalen Jobs“ – ihre Route vollendet: eine echte „Kingline“ in einem kaum bekannten Winkel des Karnischen Hauptkamms: lang, schwer und anspruchsvoll. Und mit teilweise großartigem Fels, aber auch mit einigem Gras und brüchigen Passagen – und andererseits sehr kompakten Zonen, in denen mit Friends, Keilen und Normalhaken keine befriedigende Absicherung möglich war, wie sich beim ersten Versuch, hoch überm Pecker, schnell herausstellte.
Also nutzten sie Bohrhaken – allerdings nur 31 Stück plus Standbohrhaken in den 22 Seillängen bis zum Grad 7b, bei 700 Metern Wandhöhe. Spannung und alpines Abenteuer blieb also genug: „Das Zusammenspiel von allen Gefühlsregungen haben wir in dieser Tour sehr intensiv erleben dürfen“, ist ihr Fazit, „die persönliche klettertechnische und moralische Herausforderung in einer heimischen Felswand zu bewältigen, das ist eines der Ziele, um die es im Alpinismus seit Jahrhunderten geht.“
Wenn der Gipfel auf Privatgrund liegt
Dann jedoch begann das Problem: Der Gipfel liegt auf Privatgrund des Besitzers der Valentinalpe unterhalb. Und dieser empfand die Neutour als Störung seines Besitzrechtes: Eine Erschließung brauche die Zustimmung des Grundeigentümers, meint er. Zudem störe die neue Route die natürliche Ruhezone der Region, die als Jagdgebiet genutzt wird und im Naturschutzgebiet „Wolayersee und Umgebung“ liegt.
Obendrein unterstellte er den Erschließern ein kommerzielles Interesse durch Nutzung der Route als Bergführer und Führerautoren. Die Bohrhaken müssten wieder entfernt werden, so die Forderung. Nun liegt die Sache als Klage vor dem Landesgericht Klagenfurt, mit einem Streitwert von 32.000 Euro. Und sie könnte ein wesentlicher Präzedenzfall werden für die Zukunft des Bergsports im alpinen Gelände:
Denn wenn Routen, die erstbegangen wurden, ohne vorher den Grundeigentümer ausfindig zu machen und seine Genehmigung zu bekommen, hinterher abgebaut werden müssten, wäre dies eine Hiobsbotschaft für einen Großteil der alpinen Kletterziele. Und das „freie Betretungsrecht der Natur“, das uns selbstverständlich erscheint, inklusive des Kletterns samt den dazu nötigen Sicherungsmitteln, wäre in Gefahr.
Dass dazu aktuell an mehreren Stellen gekratzt wird, zeigt die Website der Initiative „Respektiere deine Grenzen“ für Kärnten, die für ein gutes Unterwegssein des Menschen in der Natur eintritt – leider, ohne die Werte und Überzeugungen der Natursportverbände angemessen zu berücksichtigen. Bei den „Outdoor-Richtlinien“ der Initiative ist für die Disziplinen „Klettern & Klettersteig“ zu lesen: „Danke, dass du … keine neuen Routen in Felswänden einbohrst.“ Eine Erwartung, der Michael Larcher, damals stellvertretender Generalsekretär des ÖAV, in einem Brief strikt widersprochen hat: „Klettern im Gebirge ist unser Recht. Alpine Kletterrouten (Mehrseillängen) stellen – anders als Klettersteige – keine Wegeröffnung im Sinne des Gesetzes dar.
Und wenn heute Sicherungspunkte durch Bohrhaken und nicht mehr durch Schlaghaken hergestellt werden, ist dies einzig der technischen Entwicklung und der Sicherheit geschuldet.“ Auch aus diesem Grund unterstützt der Österreichische Alpenverein die verklagten Erstbegeher der Grünen Nase und ist entschlossen, die Frage, wenn nötig, bis zu einem höchstrichterlichen, abschließenden Urteil juristisch klären zu lassen.
Kommerzielles Interesse, Haftung, Beeinträchtigung der Natur?
Nun ist es in Rechtssachen so, dass letztgültige Sicherheit erst durch ein Urteil erreicht wird – im Zweifelsfall in der höchsten Instanz. Dafür muss der Richter alle Einzelpunkte einschätzen und mit Rechtsgrundlagen, Präzedenzfällen und Sachverständigen-Gutachten abgleichen. Eine Ortsbegehung durch den Richter, zumindest per Hubschrauberflug, ist schon angekündigt. Bei diesen Untersuchungen sollte sich Punkt 9 (Kommerzielles Interesse) der Argumentation der Verteidigung (siehe Kasten unten) rasch bestätigen lassen; zu Punkt 6 (Haftungsrisiko) dürften bestehende Urteile auch Klarheit schaffen, dass Haftungsängste unbegründet sind. Der Aspekt Naturschutzrecht, also Punkte 7 und 8 (Schädigung der Natur & Beeinträchtigung durch Wiederholer), hat tatsächlich in vielen Fällen und Ländern zur Einschränkung des „freien Betretungsrechts“ geführt oder zu Regulierungen für die Eröffnung von Neutouren.
Im 1959 eingerichteten Naturschutzgebiet „Wolayersee und Umgebung“ bestehen allerdings keine solchen Einschränkungen. Entscheidend dürften also die Punkte 1 bis 3 sein, nämlich ob das Betretungsrecht auch das Klettern und dessen Absichern durch Bohrhaken umfasst; und die Punkte 4 und 5, die diese Praxis als Gewohnheitsrecht untermauern – jeweils ohne Zustimmungsbedarf des Grundeigentümers.
Klettern im Gebirge ist unser Recht. Alpine Kletterrouten (Mehrseillängen) stellen – anders als Klettersteige – keine Wegeröffnung im Sinne des Gesetzes dar.
Michael Larcher

Die Logik der Argumentation – aufs Wesentlichste zusammengefasst – von Verteidigungsanwalt Dr. Simon Gleirscher
1 „alpines Ödland für den Touristenverkehr frei“
Das Kärntner Gesetz über Wegefreiheit im Bergland von 1923 enthält den Passus, dass „alpines Ödland für den Touristenverkehr frei“ sei. Dieser erlaubte „Touristenverkehr“ umfasse auch das Bergsteigen. Und zum dafür freigegebenen Ödland gehörten auch Felswände oberhalb der Waldgrenze.
2 Dafür nötige Sicherungsmaßnahmen müssen legitimiert sein
Wenn die Gesetzgebung es erlaube, sich dort aufzuhalten, müssten auch die dafür nötigen Sicherungsmaßnahmen mit legitimiert sein. Sonst wäre dieses Betretungsrecht ein „leeres“ und damit sinnloses Recht.
3 Absichern mit angemessenem Material
Zu diesen nötigen Sicherungsmaßnahmen gehörten laut „gefestigter alpiner Tradition“ auch Haken (früher Schlaghaken, heute eben Bohrhaken). Beim modernen, sportlichen alpinen Klettern seien Bohrhaken sogar eher die Regel als die Ausnahme.
4 Gesetzliche Grundlage und Gewohnheitsrecht
Neben dieser gesetzlichen Grundlage bestehe zudem ein Gewohnheitsrecht: Alpine Routen erstzubegehen, ohne vorher nach einem Grundeigentümer zu fahnden, sei eine „jahrzehntelange alpine Praxis, gegen die sich nie jemand gewehrt hat und die von einer subjektiven Rechtsüberzeugung getragen ist“, so Dr. Gleirscher. Das heißt: Man hat das schon immer so gemacht, ohne sich damit in der Illegalität zu wähnen.
5 Einverständnis des Grundeigentümers?
Ein Einverständnis des Grundeigentümers sei zwar für die Neuanlage von Klettersteigen oder Klettergärten üblich oder gar notwendig – bei alpinen Kletterrouten dagegen nicht. Im Gegenteil: Laut Gesetzeslage müsse er sie sogar dulden. Diese Position vertreten zumindest die alpinen Vereine in einem Papier, das derzeit gemeinsam mit den Österreichischen Bundesforsten erarbeitet wird.
Auch die ÖBf, Eigentümer von 15 Prozent der Fläche Österreichs, tolerieren darin das unabgesprochene „Setzen von permanenten Sicherheitseinrichtungen“ zur Eigensicherung („und ohne die primäre Absicht auf kommerzielle Nutzung durch andere“). Ob im Waldgebiet oder im Ödland, die Rechtsansicht der alpinen Vereine ist klar: „Die Erschließung einzelner Kletterrouten im Gebirge ist jedenfalls vom freien Betretungsrecht erfasst.“
6 Kein Haftungsrisiko für den Grundeigentümer
Ein Haftungsrisiko für den Grundeigentümer – in der ursprünglichen Klage gar nicht angeführt – bestehe ohnehin nicht. Bei systematisch angelegten Klettergärten mag wohl unter bestimmten Voraussetzungen eine Wegehalterhaftung ähnlich wie bei Wanderwegen und Klettersteigen bestehen, wenn versagende Installationen zu Unfällen führen (einige Klettergebiete in Frankreich sind oder waren davon betroffen).
In Österreich könnte aber selbst eine solche Haftung nur bei grob fahrlässigem Verhalten des jeweiligen „Halters“ eintreten. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Halter eines Klettergartens praktisch nie der Grundeigentümer selbst ist, sodass sich ein Geschädigter mit seinen Ansprüchen auch deshalb kaum je an den Grundeigentümer wird wenden können.
Wenn es nicht um Klettergärten geht, sondern um alpine Kletterrouten, wurde eine solche Haftung der Erstbegeher nie juristisch durchgesetzt und lässt sich auch nicht argumentieren, weil eine einzelne Kletterroute eben gar kein Weg ist. Hier zählt die Eigenverantwortung im alpinen Gelände – die das Prüfen von Haken genauso betrifft wie Aufmerksamkeit gegenüber Steinschlag oder Lawinen.
7 Keine Schädigung der Natur
Auch eine Schädigung der Natur durch die Erstbegehung oder durch Wiederholer schließt der Anwalt aus. „Inwiefern die Maßnahmen der Beklagten zu einer Beeinträchtigung von natürlichen Lebensräumen führen“ sollten, werde in der Klage nicht nachvollziehbar begründet, zumal die Bohrhaken die Felsstruktur nicht änderten.
Das nahegelegene Naturschutzgebiet werde von der Route auch nicht beeinträchtigt. Denn „Bohrhaken mit zehn Millimetern Durchmesser, die (in großen Abständen – 31 Stück auf 700 Metern Wandhöhe bedeuten einen Haken alle 20 Meter) angebracht werden“, schadeten dem Erhaltungszustand der Natur nicht.
8 Keine Beeinträchtigung durch zu viele Wiederholer
Man möchte ergänzen, dass auch eine Beeinträchtigung durch zu viele Wiederholer unwahrscheinlich ist – ein Problem, das bei Plaisirtouren eher denkbar wäre. Bei einer 22-Seillängen-Tour im oberen achten UIAA-Grad, die mit dem E-Grad E5 bewertet ist (bedeutet: schlecht abzusichern, lange Runouts, sehr schwierige Rückzugsmöglichkeiten und die Gefahr von schweren Verletzungen bei Stürzen in schwierigen Passagen), ist kaum Überfüllung zu erwarten.
9 „Kommerzielles Interesse?“
Womit auch der Vorwurf „kommerziellen Interesses“ vom Tisch sein sollte. Denn eine solche Tour – auch wenn sie die „Kingline“ durch eine der höchsten Wände der Karnischen Alpen ist – taugt weder als Cash Cow für Bergführer noch als Zugpferd zum Verkauf alpiner Führerliteratur. Die Grüne Nase bringt keine Goldene Nase.
Zur Interpretation eines Gesetzes gibt es, so Dr. Gleirscher, verschiedene Zugänge
- Die „wörtlich-grammatikalische Interpretation“ befasst sich mit dem Wortlaut des Gesetzes und der Bedeutung von Wörtern und Sätzen. Da Sprache immer mehrdeutig ist, bleibt trotz angestrebter klarer Formulierung eines Gesetzes manchmal Erklärungsbedarf – wie etwa, dass „Tourist“ in der historischen Bedeutung und somit auch im Jahr der Beschlussfassung zum Kärntner Wegefreiheitsgesetz 1923 als Synonym für die heutigen Begriffe „Bergsteiger/Alpinist“ verwendet wurde.
- Die „systematische Interpretation“ stellt eine gesetzliche Bestimmung in ihren Zusammenhang innerhalb eines Gesetzes und in Zusammenhang mit der gesamten Rechtsordnung.
- Die „teleologische Interpretation“ stellt die Frage nach dem Sinn und Zweck einer Rechtsnorm: Was wollte der Gesetzgeber erreichen? Manchmal gibt es erläuternde Bemerkungen in Gesetzeswerken oder in juristischen Kommentarschriften, die dabei helfen, dies herauszufinden.
- Zuletzt vergleicht die „historische Interpretation“ den aktuellen Gesetzestext mit Vorgänger-Versionen sowie dem historischen Kontext zum Zeitpunkt der Erlassung eines Gesetzes. Die Frage „was ist gleich geblieben, was hat sich geändert?“ hilft, das Rechtsempfinden nachzuvollziehen, dem das Gesetz Ausdruck geben soll.
Für den aktuellen Prozess wird die Bestimmung des § 5 des Kärntner Wegefreiheitsgesetzes („das Ödland ist für den Touristenverkehr frei“) nach diesen Interpretationsmethoden beurteilt und ausgelegt werden. Vielleicht wird sich dabei auch nachzeichnen lassen, wie die Machtverhältnisse zwischen den Interessengruppen – etwa Jägerschaft versus alpine Vereine – sich im alpinen Recht niedergeschlagen haben.
Im Zuge der rechtlichen Würdigung eines bestimmten Verhaltens und/oder der Auslegung eines unklaren Gesetzestextes können auch die Authentizität und Eigengesetzlichkeit beispielsweise einer Sportart gewürdigt werden, auch wenn sie etwas anders aussehen mögen als im gesellschaftlichen Alltag. Alpinismus, Apnoetauchen, Einhandsegeln sind von Exposition und Eigenverantwortung geprägt und haben ihre eigenen „ungeschriebenen Gesetze“ entwickelt. Diese stehen natürlich nicht über den formalen Regelungen, mit denen die Gesamtgesellschaft ihr Zusammenleben organisiert. Sie können aber Handlungen erklären, die im Vertrauen auf Tradition und „Gewohnheitsrecht“ des Sports geschahen.
Es gibt eigene, ungeschriebene Gesetze
An dieser Stelle kommen Sachverständige ins Spiel, deren Gutachten die notwendige Expertise in den Prozess einbringen, um die Aussagen und Interpretationen aus den Anwaltsplädoyers zu verifizieren. Die Verteidigung hat ein solches Gutachten beantragt, das belegen soll, dass „die Verwendung von Haken bei der Erstbegehung von Kletterrouten (Mehrseillängen, keine Klettergärten) im alpinen Gelände in Österreich allgemein anerkannter und praktizierter Standard“ ist. Dazu hat das Gericht dem bestellten Sachverständigen einen umfassenden Katalog von Fragen vorgelegt, die das Argumentationsgebäude von Grund auf durchleuchten sollen.
Die Fachkenntnis der Eigengesetzlichkeit unseres Sports, die uns Aktiven ab dem ersten Griff an den Fels in die Seele geschrieben und von Mentoren und der Community an-sozialisiert wird – „wie funktioniert Bergsteigen und Klettern überhaupt, was wird üblicherweise gemacht, was nicht?“ – kann solch ein Sachverständigengutachten anhand präziser Fragen in den Prozess einbringen. Auf dieser Grundlage dürfen die Prozessparteien darauf hoffen, dass das Urteil auch diese Aspekte in der Entscheidungsfindung berücksichtigt. So bleibt dem ÖAV die Hoffnung, dass am Ende des Prozesses (oder der Prozesse) höchstrichterlich das freie Betretungsrecht inklusive Klettern samt nötiger Absicherung bestätigt wird.
Eine Hoffnung auf Freiheit und Erfüllung
Darauf hoffen dürfen natürlich auch alle Freunde der Berge, die darauf vertrauen, dass die Freiheit, dort oben Freude und Erfüllung zu finden, nicht ohne nachvollziehbaren triftigen Grund beschnitten wird – weder an der Grünen Nase noch in anderen Gebieten. Egal, wie das finale Urteil aussehen wird: Um ein möglichst friedvolles Miteinander und um Verständnis für unser Gegenüber dürfen wir uns auch in Zukunft bemühen. Kann ja nie schaden, auch wenn’s nicht juristisch vorgeschrieben ist.