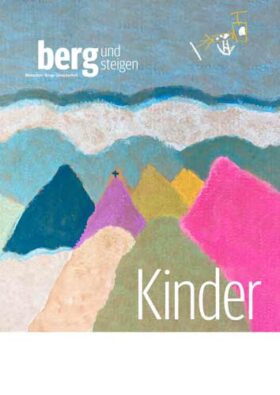Warum wir Bergsteiger so sind, wie wir sind
Versuch einer empirischen Bestandsaufnahme
Alles Großartige der Menschheitsgeschichte – ihre Meisterwerke – ist dazu verdammt, von Kitsch und Kommerz ausgesaugt zu werden. Das scheint beinahe ein Naturgesetz zu sein, geschuldet der Geschäftigkeit des Menschen.
Wer irgendein Weltkulturerbe besucht, weiß, was gemeint ist. Auch im Weltnaturerbe Dolomiten gibt es immer mehr von allem – und immer weniger Natur.

Das Meisterwerk „Donauwalzer“ von Johann Strauß wird bei Landeanflügen diverser Fluggesellschaften zur akustischen Dauerschleife degradiert, Mozarts Genialität in picksüße Kugeln gepresst.
Warum also sollte es sich mit den Meisterwerken der Bergsteigergeschichte anders verhalten?

Hanspeter Eisendle, Bergsönlichkeit in bergunsteigen #49
Meisterwerke und ihre Abnutzung
Die einen knacken sich vom Matterhorn eine Ecke ab, die anderen folgen Xenon, dem Gott der Edelgase, bis zur Mutter des Universums – Qomolangma, Sagarmatha oder kolonial vermännlicht Mount Everest.
Die angesagtesten Kletterrouten aller Generationen werden so lange wiederholt, bis jede Sanduhr gefädelt zurückbleibt, bis jeder Riss und jedes Felsloch mit Mauerhaken eingenagelt sind. Vom alpenweiten Sanierungswahn an traditionellen Routen ganz zu schweigen.
Den Fisch an der Marmolada-Südwand oder die Bonatti am Grand Capucin muss man schließlich gemacht haben. Die Pelmo-Nordwand oder die Goldkappl-Südwand nicht.

Eine nüchterne Bestandsaufnahme
Das ist weniger Kritik an Einzelnen als vielmehr eine nüchterne Bestandsaufnahme. Zu ihr gehört allerdings auch, dass ein nicht geringer, wenn auch weitaus unauffälligerer Teil der Bergsteigergemeinschaft ganz andere Intensitäten sucht.
Es sind Sammler exklusiver Lebensgefühle – Gefühle, die nur dort zu haben sind, wo Sicherheiten weniger werden und Ungewissheit sowie andere Unannehmlichkeiten zunehmen.

Die einen steigen auf Berge, um gesehen zu werden, die anderen, um zu sehen.
Unter diesen Abenteurern gibt es wiederum ganz wenige, die neue Meisterwerke schaffen, neue Meilensteine setzen und damit Begehrlichkeiten wecken. Und so werden auch diese Meisterwerke schrittweise zu alpinistischen Mozartkugeln und zu beruhigenden Tönen bei der Landung auf dem Gipfel.
Moralistisch verkürzt ließe sich sagen: Die einen steigen auf Berge, um gesehen zu werden, die anderen, um zu sehen. Doch wir sind keine Westernhelden, bei denen eindeutig Gute und Böse existieren. Wir sind komplexer.

Die menschliche Widersprüchlichkeit
Es gibt zwei Dinge, die uns von allen anderen Lebewesen grundlegend unterscheiden: die Fähigkeit zur weltweiten Vernetzung in Echtzeit und die Fähigkeit, widersprüchlich zu leben.
Wir denken und sagen das eine – und tun dann oft etwas anderes.
Diese Widersprüchlichkeit wird weiterhin Meisterwerke auf ein allgemein gebrauchsfertiges Mittelmaß zurechtstutzen. Sie ist zugleich Grundlage vieler Geschäftsmodelle rund ums Bergsteigen: urbanes Rechnen trifft auf unberechenbare Natur.

Sich entziehen
Eigentlich wollte ich meine Betrachtung mit dem Titel eines autobiografischen Romans von Joachim Meyerhoff beschließen: „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war.“ Doch das erscheint mir zu pessimistisch, zu altersgriesgrämig. Denn es gab in meinem Leben immer ein einfaches Mittel gegen den größten Unfug: mich zu entziehen.

Im Gebirge reicht es dafür, dorthin zu gehen, wo die meisten nicht sind und wo das Unbekannte größer ist als das Bekannte. Meist erleben wir das Unentdeckte in uns selbst dort am intensivsten, wo vieles um uns herum unbekannt ist.
Das kann vorübergehend sehr unangenehm sein. Doch nachher sind wir Bergsteiger fast immer nicht mehr ganz so, wie wir waren.